|
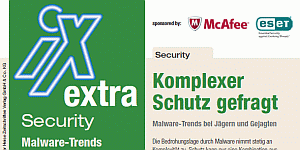
|
 Eine
interessante Studie hat Eine
interessante Studie hat
 (Heise) im
September herausgegeben: (Heise) im
September herausgegeben:

 Malware-Trends, ix 12.09.2011.
Malware-Trends, ix 12.09.2011.
Auf 12 Seiten gibt sie einen Überblick über die
wichtigsten aktuellen Erscheinungsformen der Cybercrime und bleibt dabei
auf der Erscheinungsebene. Leider bleiben die Überschriften, die wie
"Mafia-Strukturen in der Phishing-Szene" tiefere Einblicke versprechen
(S. VI), flach und ohne Aussage. Das ist der Vorteil des Papiers, das zu
einem knappen Drittel aus Werbung besteht: Man liest es schnell weg,
sagt "stimmt", fühlt sich bestätigt und nicht durch neue
Gedanken und Argumente belästigt.
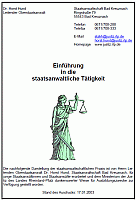  Schon von 2003 stammt die
Schon von 2003 stammt die

 Horst Hund, Einführung in die staatsanwaltliche
Tätigkeit, StA Bad Kreuznach 17.01.2003.
Horst Hund, Einführung in die staatsanwaltliche
Tätigkeit, StA Bad Kreuznach 17.01.2003.
Der leitende Kollege hat mit vielen Quellen und in klarer Sprache ein
verständliches Arbeitspapier erstellt, das einen wirklich guten Einstieg
und Überblick verschafft. Wir sind nicht immer der gleichen Meinung und
das wäre auch langweilig.
Die Quellen sind interessant und eine ist mir besonders aufgefallen (siehe
unten).
|
 Der bloße
gleichzeitige Besitz verschiedener zum Handeltreiben bestimmter Mengen
von Betäubungsmitteln, die angesichts einer Aufbewahrung an
verschiedenen Orten wie hier nicht als ein Vorrat im tatsächlichen Sinne
anzusehen sind, würde hingegen nicht genügen, die Annahme einer
Bewertungseinheit zu begründen. Der bloße
gleichzeitige Besitz verschiedener zum Handeltreiben bestimmter Mengen
von Betäubungsmitteln, die angesichts einer Aufbewahrung an
verschiedenen Orten wie hier nicht als ein Vorrat im tatsächlichen Sinne
anzusehen sind, würde hingegen nicht genügen, die Annahme einer
Bewertungseinheit zu begründen.
 (4) (4) |
|
19.11.2011
 Mit der
Bewertungseinheit
führt der BGH verschiedene gleichartige Straftaten zu einer
einheitlichen Tat zusammen ( Mit der
Bewertungseinheit
führt der BGH verschiedene gleichartige Straftaten zu einer
einheitlichen Tat zusammen ( § 52 StGB), wenn sie auf einen sich in Tatsachen äußernden
Tatentschluss zurückführen lassen. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn
ein BtM-Abhängiger eine größere Menge Rauschgift erwirbt, davon einen
Teil selber konsumiert und das übrige Gift portionsweise verkauft. Das
führt aber nicht zu beliebigen "Verklammerungen". Füllt der Täter ein
bestehendes Depot immer wieder mit Nachschub auf, so ist immer wieder
eine neue Bewertungseinheit mit der neuen Befüllung anzunehmen (was den
Nachweis und die gerichtlichen Feststellungen auch nicht einfacher macht)
§ 52 StGB), wenn sie auf einen sich in Tatsachen äußernden
Tatentschluss zurückführen lassen. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn
ein BtM-Abhängiger eine größere Menge Rauschgift erwirbt, davon einen
Teil selber konsumiert und das übrige Gift portionsweise verkauft. Das
führt aber nicht zu beliebigen "Verklammerungen". Füllt der Täter ein
bestehendes Depot immer wieder mit Nachschub auf, so ist immer wieder
eine neue Bewertungseinheit mit der neuen Befüllung anzunehmen (was den
Nachweis und die gerichtlichen Feststellungen auch nicht einfacher macht)
 (1). (1).
 (1) (1)

 BGH, Beschluss vom 26.05.2000 - 3 StR 162/00, Rn
10, hrr-strafrecht.de
BGH, Beschluss vom 26.05.2000 - 3 StR 162/00, Rn
10, hrr-strafrecht.de
Diese Rechtsprechung ist auch auf andere
Deliktstypen anzuwenden, ausdrücklich auch auf den Falschgeldhandel
 (3) und
das Skimming (3) und
das Skimming
 (2),
wobei gelegentlich auch die Rede von einer "deliktischen Einheit" ist. (2),
wobei gelegentlich auch die Rede von einer "deliktischen Einheit" ist.
 (2) (2)
 Angleichung des Rechts beim Falschgeld und Rauschgift, 13.03.2011
Angleichung des Rechts beim Falschgeld und Rauschgift, 13.03.2011
 (3) (3)

 BGH,
Beschluss vom 02.02.2011 - 2 StR 511/10
BGH,
Beschluss vom 02.02.2011 - 2 StR 511/10
Allein die Gleichzeitigkeit verschiedener Dauer-
oder Ausführungsdelikte führt allerdings nicht zur Bewertungseinheit,
wie der BGH jetzt festgestellt hat
 (4).
Verschiedene Verwahrstellen oder verschiedene Vorgehen bei der
Tatausführung schließen sie aus und machen die Handlungen zu mehreren
Taten ( (4).
Verschiedene Verwahrstellen oder verschiedene Vorgehen bei der
Tatausführung schließen sie aus und machen die Handlungen zu mehreren
Taten ( § 53 StGB).
§ 53 StGB).
 (4) (4)

 BGH, Urteil vom 21.09.2011 - 2 StR 286/11, Rn 11
BGH, Urteil vom 21.09.2011 - 2 StR 286/11, Rn 11
|
 Die Revision
rügt insoweit zu Recht die fehlerhafte Anwendung des Zweifelssatzes bei
der Beweiswürdigung des Landgerichts. Der Grundsatz in dubio pro reo ist
keine Beweisregel, sondern eine Entscheidungsregel (... Die Revision
rügt insoweit zu Recht die fehlerhafte Anwendung des Zweifelssatzes bei
der Beweiswürdigung des Landgerichts. Der Grundsatz in dubio pro reo ist
keine Beweisregel, sondern eine Entscheidungsregel (...
 (1)). Auf einzelne Elemente der Beweiswürdigung ist er grundsätzlich
nicht anwendbar (... (1)). Auf einzelne Elemente der Beweiswürdigung ist er grundsätzlich
nicht anwendbar (...
 (2)
...). Er besagt nichts darüber, wie der Tatrichter die Beweise zu
würdigen hat, sondern kommt erst bei der abschließenden Gesamtwürdigung
zum Tragen (... (2)
...). Er besagt nichts darüber, wie der Tatrichter die Beweise zu
würdigen hat, sondern kommt erst bei der abschließenden Gesamtwürdigung
zum Tragen (...
 (3)
...). (3)
...).
 (4) (4) |
|
21.11.2011
 Im Zweifel für den Angeklagten
(in dubio pro reo). Der Zweifelssatz ist aber keine Beweisregel, sondern
eine Entscheidungsregel, wie der BGH einmal wieder festgestellt hat Im Zweifel für den Angeklagten
(in dubio pro reo). Der Zweifelssatz ist aber keine Beweisregel, sondern
eine Entscheidungsregel, wie der BGH einmal wieder festgestellt hat
 (4).
Nicht jede phantastische Einlassung muss ernst genommen werden (4).
Nicht jede phantastische Einlassung muss ernst genommen werden
 (5)
und zunächst muss das Gericht solide alle Beweise im Einzelnen und in
der Gesamtschau würdigen. Erst dann, wenn am Schluss unüberwindbare
Zweifel bleiben, dann greift der Zweifelssatz als Entscheidungsregel:
Entgegen seinen begründeten Zweifeln darf kein Richter einen Angeklagten
zu Strafe verurteilen. (5)
und zunächst muss das Gericht solide alle Beweise im Einzelnen und in
der Gesamtschau würdigen. Erst dann, wenn am Schluss unüberwindbare
Zweifel bleiben, dann greift der Zweifelssatz als Entscheidungsregel:
Entgegen seinen begründeten Zweifeln darf kein Richter einen Angeklagten
zu Strafe verurteilen.
Das klingt irgendwie banal, ist aber für die
gerichtliche Praxis äußerst nachhaltig. Leicht rutscht dem Strafrichter
heraus: "Das können wir ja nie beweisen"; was meint: "Oh, ist das
kompliziert" und "oh, was für'ne Arbeit kommt auf mich zu". An dieser
Stelle ist die Staatsanwaltschaft ausnahmsweise mächtiger als das
Gericht: Wenn es um die Anklageerhebung geht, muss sie die
Verurteilungswahrscheinlichkeit prüfen und darf den Zweifelsgrundsatz
anwenden. Das Gericht, das über die Zulassung der Anklage zur
Hauptverhandlung zu entscheiden hat, darf das nicht.
Der BGH verlangt von den Gerichten diesen
Aufwand: Der Angeklagte muss ernst genommen werden, darf erwarten, dass
das Gericht seine Sichtweise wahrnimmt, verarbeitet, hinterfragt und
bewertet, er darf aber nicht zum Objekt des Verfahrens verkümmern und
schließlich darf er auch nicht erwarten, dass man ihm jeden Unsinn
abnimmt. Erst ganz am Ende muss der Richter in sich gehen, alle Fakten,
von denen er überzeugt ist, betrachten und sich eine abschließende
Meinung bilden (Gesamtschau). Erst dabei und dann greift der
Zweifelsgrundsatz.
 (1) (1)

 BGH, Urteil vom 21.10.2008 - 1 StR 292/08, Rn 24
BGH, Urteil vom 21.10.2008 - 1 StR 292/08, Rn 24
 (2) (2)

 BGH, Urteil vom 09.06.2005 - 3 StR 269/04, S. 14
BGH, Urteil vom 09.06.2005 - 3 StR 269/04, S. 14
 (3) (3)

 BGH, Urteil vom 02.09.2009 - 2 StR 229/09, Rn 16
BGH, Urteil vom 02.09.2009 - 2 StR 229/09, Rn 16
 (4) (4)

 BGH, Urteil vom 12.10.2011 - 2 StR 202/11, Rn 10
BGH, Urteil vom 12.10.2011 - 2 StR 202/11, Rn 10
 (5) (5)
 Das
Gericht muss nicht jeden Unsinn glauben, 15.10.2011 Das
Gericht muss nicht jeden Unsinn glauben, 15.10.2011
|
|
|
10.11.2011
 Das BVerfG hat sich schon 1994 tiefsinnig mit dem BtM-Strafrecht
auseinander gesetzt, dem "Recht auf Rausch" eine Abfuhr erteilt und dem
Gesetzgeber zugebilligt, verschiedene Drogen unterschiedlich zu
behandeln, insbesondere zwischen Alkohol und anderen Rauschgiften zu
unterscheiden. Es verlangt allerdings nach Korrektiven im Hinblick auf
die persönliche Schuld, die den Rahmen für Strafe bildet (Übermaßverbot),
um
Das BVerfG hat sich schon 1994 tiefsinnig mit dem BtM-Strafrecht
auseinander gesetzt, dem "Recht auf Rausch" eine Abfuhr erteilt und dem
Gesetzgeber zugebilligt, verschiedene Drogen unterschiedlich zu
behandeln, insbesondere zwischen Alkohol und anderen Rauschgiften zu
unterscheiden. Es verlangt allerdings nach Korrektiven im Hinblick auf
die persönliche Schuld, die den Rahmen für Strafe bildet (Übermaßverbot),
um
 einem
geringen individuellen Unrechts- und Schuldgehalt der Tat Rechnung zu
tragen. In diesen Fällen werden die Strafverfolgungsorgane nach dem
Übermaßverbot von der Verfolgung der in § 31a BtMG bezeichneten
Straftaten grundsätzlich abzusehen haben.
einem
geringen individuellen Unrechts- und Schuldgehalt der Tat Rechnung zu
tragen. In diesen Fällen werden die Strafverfolgungsorgane nach dem
Übermaßverbot von der Verfolgung der in § 31a BtMG bezeichneten
Straftaten grundsätzlich abzusehen haben.

 BVerfG, Beschluss vom 09.03.1994 - 2 BvL 43, 51, 63,
64, 70, 80/92, 2 BvR 2031/92, Leitsatz 3
BVerfG, Beschluss vom 09.03.1994 - 2 BvL 43, 51, 63,
64, 70, 80/92, 2 BvR 2031/92, Leitsatz 3
 In seiner
abweichenden Meinung vertritt der Bundesverfassungsrichter Simon
die Auffassung: In seiner
abweichenden Meinung vertritt der Bundesverfassungsrichter Simon
die Auffassung:
 Der
Verweis des Senats auf Vorschriften, die Staatsanwaltschaft und Gericht
das Absehen von Strafverfolgung bzw. die Einstellung des Verfahrens oder
das Absehen von Strafe ermöglichen, nimmt ferner nicht hinreichend auf
den Umstand Bedacht, daß nicht erst Verhängung und Vollziehung
staatlicher Strafe in besonderem Maße vor den Freiheitsrechten
rechtfertigungsbedürftig sind. Schon die Bezeichnung eines Verhaltens
als strafbar, aber auch die Eröffnung eines Ermittlungsverfahrens sind
grundrechtsrelevant. Jede Strafvorschrift räumt der Polizei (§ 163 Abs.
1 StPO), der Staatsanwaltschaft und dem Richter Macht über das Schicksal
anderer ein, auch wenn es letztlich nicht zu einer Anklage oder zu einer
Verurteilung kommt. Bereits die Pönalisierung eines Verhaltens als
solche schafft Leid "durch den dunklen Raum der damit einhergehenden
Erpressungen und menschlichen Erniedrigungen; durch die kritischen
Randzonen, die jedes Delikt birgt; durch die gesetzlichen und
außergesetzlichen Folgen der strafrechtlichen Reaktion für den Täter"
(Ernst- Walter Hanack, Empfiehlt es sich, die Grenzen des
Sexualstrafrechts neu zu bestimmen?, Gutachten für den 47. Deutschen
Juristentag, 1968, A 35). Der
Verweis des Senats auf Vorschriften, die Staatsanwaltschaft und Gericht
das Absehen von Strafverfolgung bzw. die Einstellung des Verfahrens oder
das Absehen von Strafe ermöglichen, nimmt ferner nicht hinreichend auf
den Umstand Bedacht, daß nicht erst Verhängung und Vollziehung
staatlicher Strafe in besonderem Maße vor den Freiheitsrechten
rechtfertigungsbedürftig sind. Schon die Bezeichnung eines Verhaltens
als strafbar, aber auch die Eröffnung eines Ermittlungsverfahrens sind
grundrechtsrelevant. Jede Strafvorschrift räumt der Polizei (§ 163 Abs.
1 StPO), der Staatsanwaltschaft und dem Richter Macht über das Schicksal
anderer ein, auch wenn es letztlich nicht zu einer Anklage oder zu einer
Verurteilung kommt. Bereits die Pönalisierung eines Verhaltens als
solche schafft Leid "durch den dunklen Raum der damit einhergehenden
Erpressungen und menschlichen Erniedrigungen; durch die kritischen
Randzonen, die jedes Delikt birgt; durch die gesetzlichen und
außergesetzlichen Folgen der strafrechtlichen Reaktion für den Täter"
(Ernst- Walter Hanack, Empfiehlt es sich, die Grenzen des
Sexualstrafrechts neu zu bestimmen?, Gutachten für den 47. Deutschen
Juristentag, 1968, A 35).
 Ebenda, Rn. 258
Ebenda, Rn. 258
 Simons Einwände sind beachtlich, aber nicht ganz überzeugend. Schon der
klassische wilhelminische Gesetzgeber hat der Staatsanwaltschaft eine
ganz wichtige Filterfunktion zugewiesen. Nur sie darf Anklage erheben (einzige
Ausnahme: Privatklage wegen besonderer privater Schutzrechte,
Simons Einwände sind beachtlich, aber nicht ganz überzeugend. Schon der
klassische wilhelminische Gesetzgeber hat der Staatsanwaltschaft eine
ganz wichtige Filterfunktion zugewiesen. Nur sie darf Anklage erheben (einzige
Ausnahme: Privatklage wegen besonderer privater Schutzrechte,
 §§ 374 ff. StPO) und wird von
§§ 374 ff. StPO) und wird von
 § 152 StPO dazu verpflichtet, tatsächlichen Anhaltspunkten
nachzugehen, die den Verdacht einer Straftat begründen. Das
Ermittlungsverfahren dient der Klärung und nicht der Bestrafung (echte
im Gegensatz zur unterschwelligen Pönalisierung, die Simon anspricht).
Tatsächlich werden die meisten Ermittlungsverfahren eingestellt und
enden ohne Anklage.
§ 152 StPO dazu verpflichtet, tatsächlichen Anhaltspunkten
nachzugehen, die den Verdacht einer Straftat begründen. Das
Ermittlungsverfahren dient der Klärung und nicht der Bestrafung (echte
im Gegensatz zur unterschwelligen Pönalisierung, die Simon anspricht).
Tatsächlich werden die meisten Ermittlungsverfahren eingestellt und
enden ohne Anklage.
Dennoch hat Simon auch recht. Andauernde strafrechtliche Ermittlungen belasten den
Beschuldigten. Er wird vom Staat bedrängt, sieht sich berechtigten oder
unberechtigten Vorwürfen ausgesetzt und unterliegt dem Druck, reagieren zu müssen und sei es dadurch, zu schweigen.
Polizei und Staatsanwaltschaft müssen sich dieser Verantwortung stellen,
die Verhältnismäßigkeit heißt. Das wichtigste Regulativ ist die strenge
Prüfung der tatsächlichen Anhaltspunkte ( Plädoyer für einen sauberen Startschuss), die auch in einem
förmlichen Verfahren erfolgen muss, das nicht ohne Datenspuren bleiben
kann, wenn seine Förmlichkeiten und Ergebnisse überprüfbar bleiben
sollen. Datenschutz mit dem Ergebnis, Datenlosigkeit zu produzieren,
verhindert auch die Kontrolle von Missbrauch und Korruption.
Plädoyer für einen sauberen Startschuss), die auch in einem
förmlichen Verfahren erfolgen muss, das nicht ohne Datenspuren bleiben
kann, wenn seine Förmlichkeiten und Ergebnisse überprüfbar bleiben
sollen. Datenschutz mit dem Ergebnis, Datenlosigkeit zu produzieren,
verhindert auch die Kontrolle von Missbrauch und Korruption.
Das Dilemma lässt sich jedoch nicht lösen. Schon deshalb nicht, weil es
jedem frei steht, unter Nennung von Anhaltspunkten Strafanzeige zu
erstatten, die die Staatsanwaltschaft prüfen muss.
|

